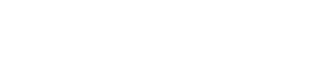Macht es wirklich Sinn einen eigenen Linux-Server aufzubauen? Die Antwort ist ein Klares: I don’t know.
Mit echtem Enthusiasmus hatte ich letztes Jahr beschlossen, die Studio-IT auf Open Source umzustellen. Irgendeine:r muss ja Zeichen setzen und die Dinge grundlegend verändern. So meine Idee. Als kleines Designstudio sollte form:f einen Beitrag zu Open Source leisten. Ein Jahr und diverse Umbaumaßnahmen später, ist nüchterner Alltag eingekehrt.
Der Linux-Server leistet klaglos seine Arbeit. Als zentrales Datenlager ist er super. Auch als Webserver und Host für die Cloud ist er gut brauchbar. Besonders dafür habe ich die „Kiste“ schätzen gelernt. Allerdings ist zur Zeit eher der Weg das Ziel. Denn das eine ist eine Idee, das andere die Umsetzung.
PC & Smartphone: der Light-Einstieg
Bis zur Inbetriebnahme des Servers war ich positiv überrascht, wie einfach es ist, auf Open Source umzustellen. Die Installation von Ubuntu auf dem Hauptrechner war unkompliziert. Ich war begeistert, dass das Betriebssystem inzwischen genauso komfortabel zu handhaben ist wie seine proprietären Kollegen. Auch das Smartphone war kein großes Ding. Der Hersteller bot von sich aus ein Open Android an – Fairphone macht’s möglich. Das OS ließ sich problemlos OTA auf das Gerät spielen. Apps waren schnell aus dem Shop gedownloaded und installiert.
Optimistisch besorgte ich die Server-Hardware, suchte die passende Anleitung zum Aufsetzen eines kleinen Linux-Servers – da gibt es unendlich viele; ich kam gut mit Techgrube klar – und legte los.
Linux-Server: die Eingeweide der Maschine
Da war dann Schluss mit lustig.
Der Server (NAS) sollte irgendwo in der Ecke stehen und ohne eigenen Monitor laufen, also musste er via „ssh“ ansprechbar ein. Da ich anfangs dachte, na, so kompliziert wird’s doch wohl nicht, verzichtete ich auf einen Window Manager. Arbeiten im Terminal war angesagt.
Es war wie Hinabsteigen in die „echte“ Rechnerwelt – in die Eingeweide der Maschine. Plötzlich war nichts mehr bunt. Einfach mal „rumklicken“ hatte sich erledigt. Jetzt hieß es, Linux-Befehle kennen lernen und einen ersten Einblick in die unterschiedliche Logik verschiedener Anwendungen bekommen. Das war spannend und…zeitraubend.
Mit dem Router per Du
Der Server selbst war natürlich nicht die einzige Baustelle. Auch der Router wollte kennen gelernt sein. Immerhin musste der Server in einem LAN-Netz laufen und mit den anderen Geräten quatschen können. Außerdem sollte er via dynamischem DNS raustelefonieren in die große weite Online-Welt. Denn die Planung sah das Hosting der Cloud vor. Der Router wollte daher eingestellt und Port-Freigaben getätigt sein. Die gute Nachricht: so schlimm war’s nicht. Inzwischen sind wir per Du.
Fazit
Geht frau/man so blauäugig wie ich an den Aufbau eines Servers ran, muss neben der Zeit für die Installation selbst auch Zeit für Hintergrundinfos eingerechnet werden.
Vor allen Dingen ist es von Vorteil, sich zu überlegen, ob frau/man generell zusätzliche Arbeit investieren möchte. Auch ein Linux-Server braucht Service: Er möchte upgedated etc. werden. Für den Webserver ist Sicherheitsservice wichtig. Schließlich darf auch ein kleiner Server nicht unerwünschten Eindringlingen Tür und Tor öffnen. Und: es steht noch ein Gerät mehr in der Gegend rum, das – wenn auch leise – sein Umfeld mit seiner Präsenz beglückt. Als Nicht-Nerd kann frau/man sich durchaus überlegen, ob ein eigener Server notwendig ist.
Nach einigem Nerv, habe ich inzwischen meinen Frieden mit ihm gemacht. Mehr noch: ich finde ihn eigentlich wieder spannend. Er ist quasi ein Experimentierfeld – ein Tür-Offner, um die Linux-Welt näher kennen zu lernen. Und um besser zu verstehen, wie Rechner „ticken“. Das praktische Wissen erleichtert den Umgang mit einigen theoretischen Digitalisierungsthemen sehr. 
Fotos + Text, Lizenz: CC BY-SA